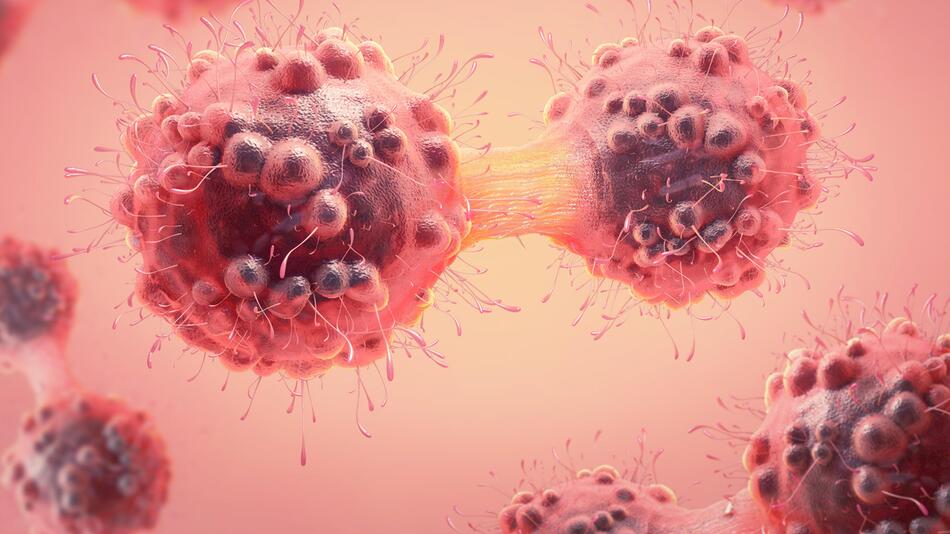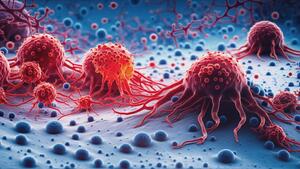Unlängst wurde in vielen Medien mal wieder der Durchbruch im Kampf gegen Krebs verkündet. Ein im Labor hergestellter Naturstoff soll die Krebstherapie revolutionieren. Ein genauerer Blick zeigt: Der angebliche Durchbruch ist ein wichtiger Schritt - aber bis der Krebs damit wirklich besiegt werden kann, ist es noch ein langer Weg.
Die Geschichte des Kampfs gegen Krebs ist voll von großen Schlagzeilen und unerfüllten Ankündigungen. Anfang April lieferte die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg eine weitere Episode und verkündete einen wissenschaftlichen Durchbruch.
Der Chemiker Dieter Schinzer hat einen Naturstoff im Labor hergestellt, der ein Kandidat für eine Krebstherapie der Zukunft sein könnte. Die Substanz heißt Disorazol Z1 und ist möglicherweise einer der aggressivsten Wirkstoffe der Welt, um Zellteilung zu verhindern. Das haben erste Tests ergeben. Wenn sich Krebszellen nicht mehr teilen, kann ein Tumor nicht mehr wachsen, der Krebs wäre besiegt.
Wirkstoff gegen Krebs muss erst Tests durchlaufen
Diese Aussicht hat einige Medien zu spektakulären Schlagzeilen getrieben. Zu Unrecht. Krebs ist durch den Erfolg im Labor natürlich nicht besiegt. Disorazol Z1 muss wie alle anderen Wirkstoffe zunächst eine lange Phase von Tests durchlaufen.
Die beginnt mit Experimenten an Krebszellen und gesunden Zellen im Labor, führt dann über Tierversuche zu den ersten klinischen Studien, bei denen die Verträglichkeit des Mittels untersucht würde. Das kann zehn Jahre dauern und länger.
Hinzu kommt: In der derzeitigen Form kommt der Wirkstoff für eine Therapie nicht in Betracht. Die Verbindung ist so toxisch, dass sie das Wachstum aller Zellen zerstört – und damit auch gesunden Zellen extrem schadet.
Wie Disorazol zum Medikament werden könnte
Disorazol Z1 könnte nur dann als Krebsmittel verwendet werden, wenn es den Forschenden gelingen würde, diese gefährliche Wirkung zu maskieren, bis das Molekül an den Tumorzellen haftet, in sie eindringt und dort seine Wirkung entfaltet. Medikamente, die nach diesem Prinzip den Krebs bekämpfen, heißen Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) und sind bereits in der Krebstherapie im Einsatz.
"Mich ärgert, dass das so gehypt wird."
Die hohe Aggressivität von Disorazol Z1 könnte die ADC-Medikamente verbessern, aber niemand weiß, ob der Ansatz sich auf dieses Molekül übertragen lässt. Und es wird sicher noch einige Jahre dauern, bis eine passende Verschleierung gefunden, angebaut und getestet wurde.
Das bestätigt auch Dieter Schinzer: "Mich ärgert, dass das so gehypt wird", sagt er in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung": "Wir haben von einem Durchbruch in der Chemie, nicht in der Medizin gesprochen."
Bodenbakterium produziert außergewöhnliche aktive Gifte
Trotzdem ist Disorazol Z1 ein spektakuläres Molekül mit einer faszinierenden Geschichte. Die gefährliche Substanz stammt aus einem unauffälligen Bodenbakterium, das auf der ganzen Welt verbreitet ist: Sorangium cellulosum. Es gehört zu den Myxobakterien und lebt in organischen Abfällen wie Ziegenmist.
Die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mögen diese Bakterienart nicht, denn sie lässt sich im Labor nur schwer kultivieren. Eine Zellteilung kann bis zu 16 Stunden dauern, da braucht es viel Geduld, bis die Forschenden größere Mengen herstellen können. Dies könnte ein Grund dafür sein, warum diese Art außergewöhnliche Gifte produziert: Weil sie sich relativ langsam vermehrt, muss sie sich schützen, damit sie überlebt.
Forschung interessiert sich plötzlich für Myxobakterien
Biologinnen und Biologen haben die Myxobakterien lange Zeit ignoriert. Erst in den 1970er-Jahren begann der Naturforscher Hans Reichenbach an der damaligen Gesellschaft für biotechnologische Forschung (GBF) in Braunschweig mit systematischen Untersuchungen. Reichenbach arbeitete mit dem Chemiker Gerhard Höfle zusammen. Die beiden entdeckten, dass diese Lebewesen kompliziert aufgebaute chemische Verbindungen herstellen, die in der Natur einzigartig sind.
Sorangium cellulosum ist die kreativste dieser Molekülfabriken. Reifenbach isolierte das Bakterium 1985 aus einer Bodenprobe von Uferschlamm des Sambesi. Inzwischen sind mehr als 200 Naturstoffe bekannt, die es produziert. Dazu gehören die Epothilone, mit denen sich die Bakterien gegen Pilzbefall wehren. 1995 entdeckten Pharmaforschende eine weitere Eigenschaft dieser vielversprechenden Substanzklasse: Sie bremsen das Wachstum von Tumoren.
2007 erteilte die US-amerikanische Aufsichtsbehörde FDA dem ersten Krebsmedikament auf Basis von Epothilonen die Zulassung. Das Mittel Ixabepilon des Pharmakonzerns Bristol-Myers Squibb darf gegen metastasierenden Brustkrebs eingesetzt werden.
Bei der Entwicklung der Krebsmedikamente sind nicht nur Medizinerinnen und Mediziner gefragt. Bevor diese ihre ersten klinischen Tests machen können, klären Chemiker und Chemikerinnen die Struktur der Moleküle auf. Dazu müssen sie aus dem vielfältigen Produktgemisch von Sorangium cellulosum die einzelnen Produkte abtrennen, reinigen und charakterisieren. Im Idealfall finden sie einen Weg, die begehrte Substanz im Labor herzustellen. Gibt es diesen von der Biologie unabhängigen Syntheseweg, dann können sie abgewandelte Versionen des Moleküls (Derivate) herstellen – Versionen, die sich für eine Therapie häufig besser eignen als das Original.
Schinzer bereits bei Epothilonen erfolgreich
Der Wissenschaftler, der damals wesentliche Beiträge für diese Aufgabe leistete, steht auch jetzt wieder im Mittelpunkt: der Naturstoffchemiker Dieter Schinzer. Er veröffentlichte 1997 die erste Totalsynthese des Naturstoffs Epothilon A, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Ixabepilon.
Mit der Totalsynthese von Disorazol Z1 ist Schinzer nun ein weiterer Coup gelungen, der wieder auf die Entwicklung eines Krebsmittels zielt. Für die Bekanntgabe der Ergebnisse hat der Wissenschaftler einen Weg gewählt, der im Forschungsbetrieb nicht üblich ist: Die Universität verkündete den Erfolg in einer Pressemitteilung, obwohl es noch keine öffentlich zugänglichen Daten zur vollständigen Laborsynthese gibt. Eine Publikation in einer Fachzeitschrift hat Schinzer bisher nicht vorgelegt. Andere Forschende können nicht überprüfen, was die Ankündigung wert ist.
Aber Schinzer ist in der Fachwelt so anerkannt, dass keine lauten Zweifel zu hören sind. Und der Wissenschaftler hat eine einfache Erklärung für sein Vorgehen: Er will erst ein Patent einreichen, bevor er Vorgehensweise und Daten publiziert. In der Krebsforschung geht es eben auch um viel Geld.
Die Naturstoffsynthese ist eine der schwierigsten Aufgaben in der Chemie. Sie bedarf einer guten Strategie und viel Beharrlichkeit. Erst müssen die Forschenden ein Konzept entwickeln, aus welchen Bausteinen sie das gesuchte Molekül zusammensetzen wollen. Dann benötigen sie Rezepturen, die in vielen kleinen Schritten zur gewünschten Substanz führen. Dabei müssen sie sich immer wieder absichern, dass sie noch auf dem richtigen Weg sind. In diesem Fachgebiet entsteht schnell Frust, weil die Synthesen nicht so klappen, wie sie zuvor auf dem Papier konstruiert wurden.
Nur wenige Labore auf der Welt verfügen über Erfahrung in der Herstellung von Disorazolen auf chemischem Weg. Das Molekül zeichnet sich durch eine ringförmige Struktur aus, die aus bis zu 30 Atomen bestehen kann. Solche Ringe sind empfindlich. Sie brechen während der Herstellung oft auseinander oder sie reagieren miteinander und bilden eine völlig andere Struktur.
Disorazole erst vor 30 Jahren entdeckt
Erst 1994 wurden die Disorazole als neue Naturstoffe charakterisiert. Es gibt mehr als 30 Varianten, die etwas einfacheren wurden 2017 synthetisiert. Disorazol Z gilt zudem als untypischer Vertreter der Disorazolfamilie. Seine Architektur mit einem 26-gliedrigen Grundkörper als Ring wurde 2007 erstmals in einer Anmeldung eines EU-Patents beschrieben. Sie ist sehr bemerkenswert. "Die Chemie um diese Verbindung ist ganz allgemein nur wenig erforscht", sagte der Naturstoffchemiker Karl-Heinz Altmann von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich, als er 2022 die Synthese einer ähnlichen Verbindung vorstellte. Deshalb ist es gerechtfertigt, wenn die Uni Magdeburg einen wissenschaftlichen Durchbruch feiert und Dieter Schinzer der SZ von einer "Champagnerparty" berichtet.
Doch was dem Menschen schwerfällt, scheint der Natur leichter zu fallen. Sorangium cellulosum hat den Syntheseweg in den Genen gespeichert. Die Kreativität des Lebewesens hat schnell weltweit das Interesse der Genetik geweckt. Ein Forschungsteam unter Leitung von Rolf Müller an der Universität des Saarlandes konnte 2007 das Erbgut des Lebewesens vollständig entschlüsseln.
Lesen Sie auch
- Früherkennung von Prostatakrebs: Bluttest in der Kritik - was ist dran?
- Keine Hinweise auf "Turbo-Krebs" nach der Corona-Impfung
Das kleine Bakterium Sorangium cellulosum besitzt etwa 10.000 Gene, etwa halb so viele wie der Mensch. Im Juni 2023 stellte Müller seine Vermutung vor, welche Gene an der Produktion der Disorazole beteiligt sind, von denen mittlerweile zehn Vertreter bekannt sind. Das öffnete die Tür für einen Syntheseweg mit den Methoden der Biotechnologie, die, einfach formuliert, Mikroben mit den nötigen Genen ausstattet, damit sie die gewünschten Produkte herstellen können. "Disorazol Z haben wir bereits in Fermentern produziert", sagt Rolf Müller, geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Instituts für Pharmazeutische Forschung Saarland.
Das wissenschaftliche Interesse an Disorazol Z1 ist in den vergangenen Jahren massiv gewachsen. Ein großer Teil der Forschung passiert in Deutschland. Das lange übersehende Myxobakterium Sorangium cellulosum könnte bald weitere Schlagzeilen machen. Doch ob Krebspatientinnen und -patienten sich über eine neue Therapie freuen dürfen, steht noch in den Sternen.
Über RiffReporter
- Dieser Beitrag stammt vom Journalismusportal RiffReporter.
- Auf riffreporter.de berichten rund 100 unabhängige JournalistInnen gemeinsam zu Aktuellem und Hintergründen. Die RiffReporter wurden für ihr Angebot mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.
Verwendete Quellen
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg: Wissenschaftlicher Durchbruch in der Chemie
- n-tv.de: Chemikern gelingt Durchbruch im Kampf gegen Krebs
- aerzteblatt.de: Antikörper-Wirkstoff-Konjugate der 3. Generation: Breite Wirkung im Tumor
- sueddeutsche.de: Wundermittel gegen Krebs? Noch nicht
- biotechnologie.de: Glückliche Odyssee der Forschung: Vom Myxobakterium zum Krebsmedikament
- onlinelibrary.wiley.com: Totalsynthese von (−)-Epothilon A
- onlinelibrary.wiley.com: Synthese und Biologische Untersuchungen von C(13)/C(13′)-Bis(desmethyl)disorazol Z
- journals.asm.org: Microbiology Spectrum: The Disorazole Z Family of Highly Potent Anticancer Natural Products from Sorangium cellulosum: Structure, Bioactivity, Biosynthesis, and Heterologous Expression
© RiffReporter