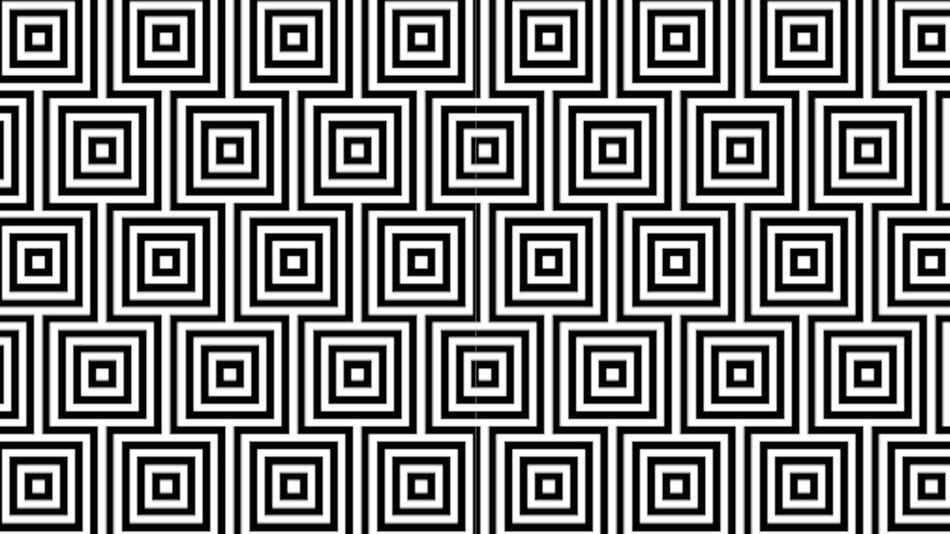Bestimmte negative Persönlichkeitszüge der Psychopathie sollen zum Erfolg von Top-Managern beitragen. Ist da etwas dran?
Anfang Januar wurde Thomas Drach zu 15 Jahren Haft verurteilt. Er soll an vier Überfällen auf Geldtransporter beteiligt gewesen sein. Für Drach ist es ist nicht die erste Gefängnisstrafe: Bereits im Alter von 13 Jahren knackte er Autos, später überfiel er einen Supermarkt und eine Bank, er besaß einen gefälschten Pass. Im Jahr 1996 schließlich entführte er den Hamburger Soziologen und Tabak-Erben Jan Philipp Reemtsma und flüchtete anschließend nach Südamerika. Anschließend stand sein Name in jeder Zeitung, und bis heute gilt er vielen als ein besonders böser Mensch.
Thomas Drach scheint ein Psychopath zu sein, wie er im Lehrbuch steht: emotionslos, skrupellos, manipulativ, ausbeuterisch, gewalttätig. Das klassische Bild, über Jahrzehnte gedeckt durch die Forschung, aus der es einst entstanden war. Doch Moment: Liest man nicht jüngst immer häufiger von Psychopathen als Top-Managern oder erfolgreichen Politikern, von der Psychopathie als Karrierevorteil? Wie passt das zusammen?
Anders als bei anderen psychischen Störungen, bei denen man sich auf die Diagnosekriterien von Klassifikationssystemen wie ICD und DSM berufen kann, gibt es keine offiziellen Kriterien für die Psychopathie. Es gibt die Diagnose "Psychopathie" gar nicht, und es gab sie auch noch nie. In den psychologischen Diagnosekatalogen lief das Phänomen lange Zeit unter dem Label der Antisozialen Persönlichkeitsstörung, im neuen ICD-11 wurde aber auch diese Kategorie gestrichen.
Dennoch wird die Bezeichnung auch in Fachkreisen verwendet. Der Rechtspsychologe Andreas Mokros von der Fernuniversität Hagen erklärt: "Bei der Psychopathie handelt es sich um eine Sonderform der Antisozialen Persönlichkeitsstörung, die geprägt ist von einem besonderen Maß an gefühlsmäßiger Kälte und einem Mangel an Empathie." Mokros forscht selbst zur Psychopathie, hat den gängigsten Test vom Englischen ins Deutsche übersetzt und war außerdem Sprecher der Fachgruppe Rechtspsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs). "Die Psychopathie führt zu Problemen im sozialen Miteinander", sagt er: Betroffene hätten Schwierigkeiten mit ihren Mitmenschen oder verursachten ihnen diese, "weil sie in hohem Maße manipulativ, eigensüchtig und gemütlos sind und keine Skrupel haben, andere auszunutzen oder für ihre Zwecke einzuspannen".
Doch dieses klassische Bild der Psychopathie begann in den vergangenen Jahren zunehmend zu zerfließen. Mehr und mehr Forscher beschäftigten sich mit subklinischen Varianten – also jenen Menschen, bei denen gewisse psychopathische Persönlichkeitszüge in geringem Maße ausgeprägt sind. Eine neue Sicht kam auf: Gewisse, eng mit der Psychopathie verwobene Persönlichkeitszüge liegen demnach in jedem und jeder von uns vor – sie können sogar von Vorteil sein. Es kommt nur darauf an, wie stark sie ausgeprägt sind und wie man sie handhabt.
Das Aufweichen der starren Kategorien vollzieht sich derzeit bei vielen psychischen Störungen: Das eindimensionale Denken mit den klassischen, schubladengleichen Krankheitsbildern weicht eher beschreibenden Symptom-Sammlungen. Diesem Umgang aber wollen insbesondere bei der Psychopathie nicht alle Forscherinnen und Forscher folgen.
Die Definition von Psychopathie sei über gut 40 Jahre stabil gewesen, sagt Rechtspsychologe Mokros. In den letzten Jahren habe der Begriff der Psychopathie eine Aufgliederung erfahren. "Und mittlerweile ist gar nicht mehr so recht klar, was gemeint ist, wenn Wissenschaftler oder auch Laien 'Psychopath' sagen. Es ist eine gewisse Begriffsverwirrung eingetreten."
Aus dem Gefängnis in die breite Öffentlichkeit – die Geschichte der Psychopathie-Forschung
Um die Veränderungen besser zu verstehen, hilft ein Blick in die Geschichte der Psychopathie-Forschung. Begonnen hat sie unter anderem mit der Arbeit Hervey Cleckleys. Hatte der einflussreiche Psychiater Kurt Schneider in den 1920er-Jahren noch alle Persönlichkeitsstörungen als Psychopathien bezeichnet, war es der US-amerikanische Psychiater Cleckley, der in seinem 1941 erschienenen Buch "The Mask of Sanity" der Psychopathie ein prägnantes Gesicht gab. Auf der Grundlage von Interviews mit Patienten in Psychiatrien formulierte er darin das prototypische Bild eines Psychopathen: unehrlich, unsicher, unzuverlässig, schamlos, manipulativ, unfähig zu lieben und frei von Emotionen und Empathie. Aber, vor allem nach außen hin, auch: charmant, intelligent, kaum nervös. Das Buch wurde zu einer der einflussreichsten Schriften zum Thema Psychopathie, es prägt bis heute das öffentliche Bild von Psychopathen.
Einen weiteren Meilenstein der Psychopathie-Forschung setzte der kanadische Kriminalpsychologe Robert Hare im Jahr 1980. Auf Grundlage der Beschreibungen Cleckleys und der Erkenntnisse seiner eigenen Arbeit mit Gefängnisinsassen aus Vancouver veröffentlichte Hare die "Psychopathy-Checklist" – ein psychologisches Messinstrument, mit dem die jeweilige Psychopathie-Ausprägung von Menschen bestimmt werden kann. Im Jahr 1991 erschien eine überarbeitete Version, die "Psychopathy-Checklist – Revised" (PCL-R), deren zweite und aktuelle Auflage erschien 2003.
Bei der PCL-R handelt es sich nicht nur um einen schlichten Fragebogen. Da er für den Einsatz bei Straftätern konzipiert wurde, ergänzten die Fachleute ihn stattdessen um Informationen aus den Akten der Begutachteten. Im Ergebnis wird ein Zahlenwert zwischen null und 40 Punkten ermittelt; ab einem Wert von 25 oder 30 – hier gibt es internationale Unterschiede in der Anwendung – attestieren die Gutachter eine Psychopathie. Theodore Robert "Ted" Bundy, ein amerikanischer Serienmörder, der in den 1970 er-Jahren mindestens 30 junge Frauen und Mädchen umgebracht hat, soll einen Wert von 39 Punkten erreicht haben.
Lesen Sie auch
Die PCL-R erfasst dabei zwei Faktoren von Psychopathien. Der erste soll die psychopathischen Kernmerkmale abbilden und enthält die Facetten "interpersonell" und "affektiv". Der zweite Faktor steht für soziale Abweichung und enthält die Facetten "Lebenswandel" und "antisozial". Beide Faktoren lassen sich in weitere Facetten aufspalten.
Mit Robert Hares Checkliste, insbesondere mit der Neuauflage, fand die Psychopathie-Forschung ihren Weg in die Allgemeinbevölkerung. Studien fanden nicht mehr mit Gefangenen oder Patienten in Psychiatrien statt. Stattdessen untersuchten Forscherinnen und Forscher die Psychopathie-Ausprägung von erfolgreichen Geschäftsleuten, Profi-Sportlerinnen, Schauspielern oder anderen gesellschaftlichen Gruppen.
Studie um Studie brachte neue Befunde. Etwa: Hohe Psychopathie-Werte hängen zwar mit zwischenmenschlichen Problemen zusammen, aber auch mit hoher Kreativität, besserem strategischen Denken und Kommunikationsfähigkeiten. Einige psychopathischen Merkmale korrelieren auch mit Zielstrebigkeit und hoher Leistungsfähigkeit im Sport.
Ein bisschen Psychopathie hilft bei der Karriere – stimmt das so wirklich?
Insbesondere im Unternehmenskontext fanden sich zahlreiche positive Zusammenhänge: Manager haben bei oberflächlichem Charme, Egozentrizität, Mangel an Empathie und Überzeugungskraft höhere Werte als Psychiatriepatienten und Straftäter. Oder: Jene Psychopathen, die durchsetzungsstark sowie stressresistent sind und keine Angst vor den Konsequenzen ihrer Handlungen haben, werden von ihren Kolleginnen und Kollegen mitunter sehr geschätzt. Nicht hingegen jene, die rücksichtslos sind und keine Selbstkontrolle besitzen.
So entwickelte sich nach und nach die Idee, Psychopathie könne ein Erfolgsfaktor sein. Zu den zentralen psychopathischen Merkmalen, die als potenziell vorteilhaft gelten, gehören insbesondere der oberflächliche Charme, das Manipulationsgeschick, die Emotionslosigkeit, eine geringe Ängstlichkeit und ein Mangel an Empathie, Schuldgefühlen und Gewissensbissen. Alles natürlich nur in mäßiger Ausprägung. Der Psychologe Kevin Dutton von der University of Adelaide hat mit "Die Weisheit der Psychopathen – Lebensweisheiten von Heiligen, Spionen und Serienmördern" einen Bestseller geschrieben. Er findet, dass man sich bei Psychopathen Rücksichtslosigkeit, Charme, mentale Robustheit und Furchtlosigkeit abschauen dürfe, um im eigenen Leben erfolgreicher zu werden.
Ein bisschen Psychopathie ist also ganz wünschenswert? Diese Auffassung ist umstritten. Die beiden Psychologie-Fachleute Kent Kiehl und Julia Lushing halten "erfolgreiche Psychopathie" etwa für ein Oxymoron. "Es ist ein Widerspruch in sich, zu behaupten, dass jemand ein 'erfolgreicher' Psychopath ist", schreiben sie. Denn um von einer Persönlichkeitsstörung wie Psychopathie betroffen zu sein, müsse man per Definition pathologische Symptome aufweisen, die zu einer Beeinträchtigung in mehreren Bereichen des Lebens führen.
Kann ein Blick auf die Statistik weiterhelfen? Wenn ein wenig Psychopath in jedem steckt, müsste sich dies in den Diagnosen widerspiegeln. Die Organisation PsychopathyIs, die über Psychopathie aufklärt und Betroffenen und Angehörigen Unterstützung bietet, schreibt auf ihrer Website: "Es wird geschätzt, dass etwa 70 Prozent der Bevölkerung keinerlei psychopathische Züge aufweisen. Die restlichen 30 Prozent weisen ein niedriges, mittleres oder hohes Maß an Psychopathie auf." Beinahe ein Drittel aller Menschen soll also psychopathische Züge aufweisen, ein bisschen zumindest.
Die Zahlen stammen aus einer Studie eines Teams um den PCL-Entwickler Robert Hare, das in der amerikanischen Allgemeinbevölkerung nach psychopathischen Zügen gesucht hatte. Die 30 Prozent der obigen Aussage beziehen sich auf folgende Beobachtung der Untersuchung: 70,8 Prozent der 638 Teilnehmenden hatten am Ende null Punkte – also hatten im Umkehrschluss 29,2 Prozent mindestens einen Wert von eins. Den Wert für "mögliche Psychopathie" (ab 13 Punkten) erreichten vier männliche Teilnehmer, einer von ihnen lag sogar auch über dem Wert für "wahrscheinliche Psychopathie" (ab 18 Punkten).
Ist es womöglich gar nicht schlimm, ein bisschen psychopathisch zu sein?
Rechtfertigt dieses Ergebnis den Schluss des Erfolgsautors Dutton, dass "ein wenig Psychopath zu sein" nicht schlecht sein muss? Eines jedenfalls scheint bei der Debatte um die Verbreitung psychopathischer Züge aus dem Fokus geraten zu sein – nämlich die Frage, warum man ein solches Label überhaupt braucht. Üblicherweise sollen Kategorien dazu dienen, Betroffenen zu helfen. Vielleicht würde es jenen vier Teilnehmern der Studie, die tatsächlich höhere Ausprägungen zeigten, eher helfen, wenn sie nicht in derselben Kategorie landeten wie jemand, der nur einen einzelnen Punkt erreicht hat.
Denn in der Studie des Hare-Teams wurde auch untersucht, wie es den Befragten geht. Es zeigte sich, dass Psychopathie für sie einige negative Konsequenzen hatte. So schreiben die Autoren: "Die Ergebnisse unserer Studie deuten darauf hin, dass erhöhte psychopathische Züge für nicht inhaftierte und nicht psychiatrische Personen eine Beeinträchtigung mit verschiedenen negativen Folgen haben." Ihre Zahlen zeigten, dass psychopathische Züge mit zahlreichen sozialen und Verhaltensproblemen und einer erheblichen Komorbidität mit psychischen Störungen in Zusammenhang standen: Je höher der Wert, desto häufiger war jemand kriminell, häuslich gewalttätig, musste ins Gefängnis oder in die Psychiatrie, war obdachlos oder erkrankte an Zwangs- oder Panikstörungen.
Der Rechtspsychologe Andreas Mokros von der Fernuniversität Hagen sagt dazu: "Natürlich ist Psychopathie ein dimensionales Phänomen. Jeder hat ein klein bisschen von diesen Eigenschaften und manche eben ganz viel." Und natürlich wird nicht jeder, der eher gefühlskalt ist, gleich zu einem Serientäter wie Thomas Drach. Aber man müsse zwischen der ursprünglichen, eher klinisch bedachten Definition der Psychopathie und der heute verbreiteten, eher breiten Verwendung des Begriffs unterscheiden. "Es heißt heute schnell, dass Psychopathie auch gut und hilfreich sei oder einem Wettbewerbs- und gar Karrierevorteile bringe, etwa im Geschäftsleben", sagt Mokros. "In den allermeisten Fällen ist das aber nicht so."
Über RiffReporter
- Dieser Beitrag stammt vom Journalismusportal RiffReporter.
- Auf riffreporter.de berichten rund 100 unabhängige JournalistInnen gemeinsam zu Aktuellem und Hintergründen. Die RiffReporter wurden für ihr Angebot mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.
Verwendete Quellen
- Gespräch mit Andreas Mokros, Rechtspsychologe von der Fernuniversität Hagen
- sciencedirect.com: A research scale for the assessment of psychopathy in criminal populations
- psycnet.apa.org: Psychopathy Checklist—Revised
- drkevindutton.com: The Wisdom of Psychopaths
- psychopathyis.org: Our Mission
- sciencedirect.com: The assessment of psychopathy in male and female noncriminals: Reliability and validity
© RiffReporter


"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.