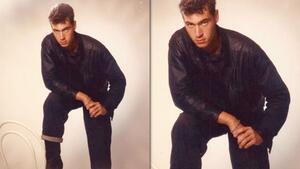In ganz Deutschland gingen am vergangenen Wochenende Hunderttausende Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Ein Forscher ordnet die Proteste ein.
In ganz Deutschland haben Hunderttausende Menschen Flagge gegen Rechtsextremismus gezeigt. Anlass waren die Enthüllungen der Recherche-Plattform "Correctiv" zu den geheimen Treffen einiger AfD-Mitglieder, auf denen die Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund besprochen wurde. Wie groß ist der Einfluss dieser Demonstrationen und was kann sich daraus entwickeln?
Dr. Philipp Knopp ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bertha-von-Suttner-Universität St. Pölten. Er forscht zu Protest- und sozialen Bewegungen. Unsere Redaktion hat ihn zu den Demonstrationen befragt.
Sind Demos von dieser Größenordnung eher ein einmaliges Ereignis, oder können sie sich auch in diesem Ausmaß als längerfristige Bewegung etablieren?
Philipp Knopp: Wir können diese Proteste in eine bereits bestehende längerfristige Bewegung einordnen. Wenn wir in die 2010er-Jahre zurückgehen und die Proteste gegen die Pegida-Bewegung anschauen, dann waren damals schon mehrere Zehntausend Menschen auf der Straße. Insbesondere in Dresden, wo die Pegida-Proteste stattfanden, waren damals regelmäßig Menschen auf der Straße. Diese zivilgesellschaftliche Bewegung gegen Rechtsextremismus hat also eine gewisse Kontinuität in Deutschland.
Experte: "Das erklärt die Besonderheit dieser Proteste"
Inwiefern haben die Recherchen zu geheimen Treffen der AfD hier etwas ausgelöst?
Die Recherchen von "Correctiv" haben noch einmal die Ernsthaftigkeit der Situation vor Augen geführt und Menschen auf die Straße gebracht, die vorher nicht Teil der gesellschaftlichen Zivilgesellschaft waren. Das erklärt die Besonderheit dieser Proteste. Ob das eine längerfristige Bewegung werden wird, hängt sicherlich auch davon ab, wie weiter verfahren wird.
Was bedeutet das konkret?
Auf Social Media finden Debatten statt, was die Forderung dieser Bewegung sein könnten. Dafür wird also gerade ein Rahmen debattiert. Dieser muss inklusiv sein und die verschiedenen Akteure mit aufnehmen, aber gleichzeitig eine Opposition zur Regierung mitaufnehmen. Dann müsste eine bestimmte Kultur entwickelt werden – Rituale, Slogans, Logos. Außerdem ist die Frage, ob es den Akteuren möglich ist, eine bestimmte Struktur aufzubauen. Diese Aufgabe müssten wahrscheinlich die zivilgesellschaftlichen Akteure übernehmen. Letztlich wäre es wichtig, ob es den Protestierenden gelingt, eine Alltagspraxis zu entwickeln. Das bedeutet, inwiefern sich die alltäglichen Begegnungen mit Extrem-Rechten gestalten, gerade in AfD-Hochburgen beispielsweise im Osten Deutschlands.
Lesen Sie auch
- Habeck: Demokratische Mehrheit muss in Lage sein, Probleme zu lösen
- Ostbeauftragter fordert nach Demos konkretes Engagement
Bei den Demonstrationen sind auch linke Parteien und die Antifa beteiligt. Inwiefern ist es aber auch die Mitte der Gesellschaft, die sich hier engagiert?
Die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die dort vertreten waren, sind die Mitte der Gesellschaft. Außerdem ist es schwierig, diese Proteste politisch einzuordnen, bevor sie überhaupt politische Forderungen formuliert haben. Es ist aber sicher so, dass viele Menschen beteiligt waren, die sich sonst nicht politisch betätigt oder zivilgesellschaftlich engagiert haben. Da ist ein Potenzial für eine mögliche Bewegung gegen Rechts. Hier ist wiederum die Frage, wie dauerhaft diese Menschen eingebunden werden.
Klammert man die Klimaproteste aus, war in den vergangenen Jahren besonders die politische Rechte erfolgreich darin, ihre Anhänger zu Demos zu mobilisieren. Verändert sich hier durch die aktuellen Proteste die Demonstrationskultur?
Da möchte ich Ihnen widersprechen: Dass wir solche Massenbewegungen von Rechts haben, ist etwas Neues, das erst durch Pegida groß geworden ist. Mit Beginn der Corona-Pandemie ist die linke Protestkultur etwas eingeschlafen – in Teilen gilt das auch für die Klimaproteste. Ich würde daher eher sagen: Die Corona-Lethargie bei der linken Protestkultur hat hier gerade ein Ende gefunden und es findet eine Renaissance statt.
"Damit wird eine Haltung artikuliert, aber kein politischer Handlungsbedarf formuliert"
Kritiker sagen, die aktuelle Debatte begünstige eher die AfD, können Sie die Kritik nachempfinden?
Nicht wirklich. Die AfD steht ohnehin im Mittelpunkt des Interesses. Das hat damit zu tun, dass sie stark medial vertreten ist und in den Umfragen ohnehin gute Werte hat. Sie ist in Talkshows und eine Stimme im politischen Diskurs geworden. Außerdem ist sie nicht nur selbst als Sprecherin im Diskurs präsent, sondern ihre Forderungen wurden inzwischen schon von Parteien der Mitte übernommen. Damit ist die Bewegung aus dem Diskurs ein Stück weit herausgetreten. Es wird nicht mehr versucht, der AfD dadurch zu begegnen, dass man ihre Positionen übernimmt, sondern die Demonstranten erklären, dass man nicht mehr möchte, dass die AfD den politischen Diskurs in dieser Weise dominiert.
Sind die Demonstrationen mit ihrer Positionierung "gegen Rechts" zu allgemein gehalten, um eine politische Aussage zu definieren?
Ja, das sehe ich ebenfalls so. Damit wird zwar eine Haltung artikuliert, aber kein politischer Handlungsbedarf formuliert. Wie das genau aussehen soll, was "gegen Rechts" genau bedeutet, bleibt offen. Soll das für ein AfD-Verbot sprechen oder eine andere Migrationspolitik fordern? Das bleibt unklar. Da bleibt in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten zu beobachten, wie sich aus diesem Moment, den wir gerade erleben, eine politische Bewegung formiert – oder eben nicht.
Bei den Demos in Berlin und in München wurde teilweise auch die Ampel und die Union scharf kritisiert. Schadet das dem eigentlichen Anliegen, gegen extremistische Kräfte zu demonstrieren?
Dass diese Proteste Forderungen formulieren und eine gewisse Reibungsfläche erzeugen müssen, gehört dazu. Wenn man keine Ziele formuliert, kann man sie auch nicht erreichen. In dem Sinne muss der Protest auch die Regierenden kritisieren, sonst ändert sich nichts. Die AfD wird sich auf die Ziele der Demonstrierenden ohnehin nur bedingt einlassen.
Weitere News gibt's in unserem WhatsApp-Kanal. Klicken Sie auf "Abonnieren", um keine Updates zu verpassen.
Über den Gesprächspartner
- Dr. Philipp Knopp ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bertha-von-Suttner-Universität St. Pölten. Er forscht zu Protest- und sozialen Bewegungen.
Verwendete Quellen
- Correctiv.org: "Geheimplan gegen Deutschland"
- Gespräch mit Philipp Knopp